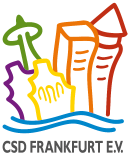1999 – Gleiche Partnerschaftsrechte in Deutschland und Europa!
 Die Familie feiert Geburtstag –
Die Familie feiert Geburtstag –
30 Jahre CSDs – Von der Revolution zur Touristenatraktion
Der Christopher-Street-Day (CSD) gilt heute weltweit als höchster Feiertag von Lesben und Schwulen. Zehntausende ziehen durch die Metropolen, um den größten und schrillsten Party-Event im schwul lesbischen Kalender zu begehen. So alt wie der CSD ist auch der Streit um die Frage, wie politisch es denn, bitteschön, hierbei zugehen soll.
Für manche ist ja die bloße Ansammlung von ein paar tausend „bekennenden“ Lesben und Schwulen politische Demonstration genug. Und sicher: in den 70er Jahren galten die ersten Homo-Demos noch als Sensation, in der AIDS-Hysterie der 80er brauchte es Mut, öffentlich Flagge zu zeigen, und in den 90er Jahren entwickelte sich der CSD in Deutschland zum Spektakel einer emanzipierten Masse: „We are family“, dieses Lebensgefühl strahlt der CSD für viele aus, und nicht zuletzt schöpfen manche Lesbe und mancher Schwule aus dem Erlebnis, mit dem Homo- Schicksal nicht allein zu sein, Kraft für den grauen Alltag irgendwo in der Provinz.
Und selbst diese wird von dem bunten Treiben nicht mehr verschont: In Hessen zogen zuletzt 1997 Hunderte von Lesben und Schwulen in einem ausgelassenen und bunten Zug durch die Innenstadt von Marburg – Rathaus und Marktplatz waren zu diesem Anlaß sogar mit den Flaggen der Stadt und den bunten Regenbogen- Fahnen der Bewegung geschmückt. Sind wir nach 30 Jahren also endlich am Ziel angekommen?
Die Wurzeln des CSD liegen in New York. Im Juni 1969 versuchte die Polizei dort im Stadtteil Greenwich Village einige Stammgäste des Stonewall Inn, einer Homobar in der Christopher Street, festzunehmen. Angeblich wurde gegen ein Verbot verstoßen, das in der Rückschau absurd erscheint: Männer durften damals nicht miteinander tanzen!
Doch diesmal wehrten sie sich, und zwar handfest. Auch auf der Straße vor dem Stonewall Inn eskalierte die Situation: Sympathisierende Passanten, unter ihnen viele Drag Queens und Lesben, reihten sich in den Widerstand ein, zunächst mit Pfeifkonzerten und Buhrufen, dann mit körperlicher Gewalt. Die Auseinandersetzungen dauerten mehrere Tage und Nächte an.
Die Gay Liberation Front erhielt durch den Stonewall-Aufstand starken Auftrieb. Sie orientierte sich politisch an den linken Befreiungsbewegungen der späten 60er Jahre und wurde zunehmend militanter. In den Vereinigten Staaten fand die aufblühende Schwulenbewegung ein beachtliches Maß an öffentlicher Aufmerksamkeit, und die Bewegung schwappte auch nach Europa und somit in die Bundesrepublik herüber.
West-Deutschland war zu dieser Zeit durch die 68er-StudentenUnruhen geprägt. Der „Muff von tausend Jahren“ sollte gelüftet, festgefügte Strukturen ins Wanken gebracht werden. Die Pille erleichterte es den Frauen, tradierte Rollenmuster zu verlassen und die bis dahin starren Geschlechterrollen vehement in Frage stellten. Auch die Schwulen profitierten von dem liberaler werdenden Klima. Nach Jahrzehnten der Unterdrückung und Verfolgung wurde am 9. Mai 1969 der Strafrechtsparagraph 175 gelockkert – zum ersten Mal nach fast 100 Jahren. Nun war es möglich, Diskriminierungen und Diffamierungen offensiver zu bekämpfen.
Die Vorreiter kamen aus dem studentischen Spektrum. An den Hochschulen ließen sich selbstbestimmte Lebensentwürfe leichter definieren und praktizieren. So gründete sich im Dezember 1970 in Bochum die erste studentische Selbsthilfegruppe mit dem Namen Homosexuelle Aktionsgruppe Bochum (HAB). Im April 1971 folgte die Homosexuelle Studentengruppe Münster (HSM). Dabei war der Name durchaus Programm: Während sich bürgerli che Verbände schamhaft als „homophil“ bezeichneten, wollten sich die studentischen Gruppen von dieser Verklemmtheit absetzen.
Sie brachen bewußt mit der Strategie, Promiskuität und Sexualpraktiken, die den Normalbürger schreckten, vor der Öffentlichkeit zu verbergen. Die studentischen Emanzipationsgruppen wollten sich nicht länger in ein Doppelleben pressen lassen: tagsüber angepaßt und nachts schwul. Die politischen und die bürgerlichen Schwulen – hier wurde die Trennlinie deutlich sichtbar.
Die TV-Ausstrahlung von Rosa von Praunheims Film „Nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern die Situation, in der er lebt“ am 31. Januar 1972 brach schließlich das Eis. Die neue Schwulenbewegung in der Bundesrepublik griff um sich, in Berlin, Frankfurt und vielen anderen Städten gründeten sich weitere Aktionsgruppen, die häufig vom zeittypischen revolutionäre Geist geprägt waren. Die Diskriminierung der Homosexualität wurde als Teil der patriarchalen Unterdrückung im kapitalistischen System begriffen. Allein, in den zahlreichen kommunistischen und marxistischen Gruppen herrschten ähnliche Mechanismen vor; Frauen, Lesben und Schwule hatten auch dort theoretisch wie praktisch selten etwas zu lachen.
Die erste Schwulendemo in der deutschen Geschichte fand im April 1972 als krönender Abschluß einer Tagung in Münster statt. „Mach Dein Schwulsein öffentlich!“ hieß fortan das zentrale Motto der Bewegung, dem viele nicht folgen konnten oder mochten. Die Absicht war es, die Öffentlichkeit mit realen Schwulen zu konfrontieren – denn nur so glaubte man, althergebrachte Klischees überwinden zu können. Doch nicht alle waren so selbstbewußt und mutig – die über Jahrzehnte greifende Verfolgung und Ausgrenzung saß zu tief, die revolutionäre Bewegung überforderte viele Homosexuelle.
Gleichwohl ließ sich der Aufbruch der neuen Emanzipationsbewegung nicht mehr stoppen. Die Berliner HAW organisierte 1973 ein schwules Pfingsttreffen unter dem Motto: „Die Unterdrückung der Homosexualität ist nur ein Spezialfall der allgemeinen Sexualunterdrückung“. Damit wurde erstmals ein breites Publikum angesprochen, und die Aktionsformen spiegelten bereits damals wider, was rund um den CSD in den verschiedenen Städten auch heute noch zu finden ist.
Bei allen Querelen, Schwierigkeiten und Zerwürfnissen – die homosexuelle Emanzipationsbewegung hat sich in der Bundesrepublik (und unter anderen Voraussetzungen in der DDR) ihren Raum geschaffen. Sechs Jahre nach dem Pfingstreffen, am 30. Juni 1979, organisierten eine Handvoll Aktiver in Berlin und Bremen eine Demonstration zum Gedenken an den Aufstand von 1969 im Stonewall Inn. Nach amerkanischem Vorbild wollte man auch in Berlin und Bremen mit bunten Umzügen diesen Aufstand feiern – und so geschieht es bis heute.
Dem staunenden Publikum wird dabei nicht mehr und nicht weniger als lesbisches und schwules Selbstbewußtsein vorgeführt, der Stolz darauf, „ganz normal anders“ zu sein. Die revolutionäre Message von einst ist zwar gewichen, die Wurzeln des Christopher-Street-Day aber, die im Kampf für gleiche Recht liegen, sind längst nicht gekappt. Nicht zuletzt gibt es. gerade auch in Hessen, erste politische Erfolge der Emanzipationsbewegung.
Jeden Sommer gehören die Innenstädte der Metropolen dem bunten Homo-Volk. Insbesondere in Köln und Berlin ist der CSD Wirtschaftsfaktor wie Touristenmagnet geworden. Hinter all dem steckt eine ganz schöne Portion gay power – Kraft, die für den Rest des Jahres reichen muß, um für Gleichberechtigung und Solidarität zu streiten.
(Stefan Mielchen)